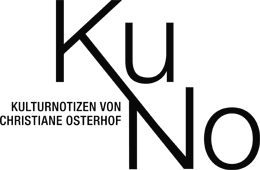Europas Realitäten
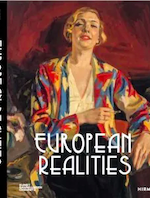 In Deutschland zählt sie längst zu den wichtigsten Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts, aber gab es so etwas wie die „Neue Sachlichkeit“ auch jenseits der Grenzen? Mit rund 300 Werken aus 20 Ländern beweist das Chemnitzer Museum Gunzenhauser mit der Ausstellung „European Realities“ gerade, wie man sich in den zwanziger Jahren überall in Europa – nicht zuletzt als Reaktion auf die Katastrophe des Ersten Weltkriegs – kritisch mit der gesellschaftlichen Realität auseinandersetzte. Abstraktion und Expressionismus galten als gestrig, was sich auf den Strassen und Plätzen, in den Restaurants und Salons, den Fabriken und Büros abspielte, interessierte Künstler wie Otto Dix oder seine spanische Kollegin Maria Blanchard, Und dabei wurden auch ganz neue Themen entdeckt: der Sport etwa und vor allem die Rolle der Frauen. Selbstbewusst und schick in Schale blicken sie den Betrachter an, denn soviel war klar, eine neue Zeit war angebrochen. In Chemnitz (noch bis zum 10. August) und im begleitenden Katalog ist zu sehen, mit welch künstlerischem und sozialem Engagement europäische Maler darauf reagierten. PM
In Deutschland zählt sie längst zu den wichtigsten Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts, aber gab es so etwas wie die „Neue Sachlichkeit“ auch jenseits der Grenzen? Mit rund 300 Werken aus 20 Ländern beweist das Chemnitzer Museum Gunzenhauser mit der Ausstellung „European Realities“ gerade, wie man sich in den zwanziger Jahren überall in Europa – nicht zuletzt als Reaktion auf die Katastrophe des Ersten Weltkriegs – kritisch mit der gesellschaftlichen Realität auseinandersetzte. Abstraktion und Expressionismus galten als gestrig, was sich auf den Strassen und Plätzen, in den Restaurants und Salons, den Fabriken und Büros abspielte, interessierte Künstler wie Otto Dix oder seine spanische Kollegin Maria Blanchard, Und dabei wurden auch ganz neue Themen entdeckt: der Sport etwa und vor allem die Rolle der Frauen. Selbstbewusst und schick in Schale blicken sie den Betrachter an, denn soviel war klar, eine neue Zeit war angebrochen. In Chemnitz (noch bis zum 10. August) und im begleitenden Katalog ist zu sehen, mit welch künstlerischem und sozialem Engagement europäische Maler darauf reagierten. PM
European Realities. 384 S. 300 Abb. Hirmer. 58 Euro.
Kunst macht nicht immer glücklich!
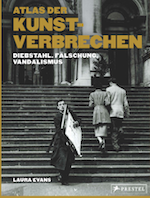 Meistens geht es um Geld, wenn Kunst gestohlen oder gefälscht wird. Gelegentlich gibt es aber auch andere Gründe, politische zum Beispiel, wie 1956, als irische Studenten ein Gemälde aus der Tate Gallery in London stahlen, um die Sammlung von Sir Hugh Percy Lane zurück nach Irland zu holen. Oder aber künstlerische, wie die von Frank Uwe Laysiepen, genannt Ulay, der 1978 Spitzwegs „Der arme Poet“ aus der Berliner Nationalgalerie entführte und es in Kreuzberg einer türkischen Familie ins Wohnzimmer hängte. Leider versucht auch immer wieder jemand, Kunst zu zerstören, um auf ein Anliegen aufmerksam zu machen.
Meistens geht es um Geld, wenn Kunst gestohlen oder gefälscht wird. Gelegentlich gibt es aber auch andere Gründe, politische zum Beispiel, wie 1956, als irische Studenten ein Gemälde aus der Tate Gallery in London stahlen, um die Sammlung von Sir Hugh Percy Lane zurück nach Irland zu holen. Oder aber künstlerische, wie die von Frank Uwe Laysiepen, genannt Ulay, der 1978 Spitzwegs „Der arme Poet“ aus der Berliner Nationalgalerie entführte und es in Kreuzberg einer türkischen Familie ins Wohnzimmer hängte. Leider versucht auch immer wieder jemand, Kunst zu zerstören, um auf ein Anliegen aufmerksam zu machen.
Die Professorin Laura Evens, die in Texas Kunst- und Museumspädagogik lehrt, hat für ihr Buch 75 Kunstverbrechen zusammengetragen. Mit dabei sind der Diebstahl von Claude Monets Gemälde „Marine“ und anderen während des Karnevals in Rio de Janeiro 2006, der Raub einer Kopie der „Kreuzigung“ von Pieter Brueghel dem Jüngeren aus einer italienischen Kirche, die das Original vorher ersetzt hatte, weil die Polizei gewarnt worden war.
Und auch die Entwendung der „Mona Lisa“ aus dem Pariser Louvre am 21. August 1911 wird ausführlich geschildert, und die hatte ziemliche skurrile, überraschende und auch lustige Folgen. Siehe auch die nächste Besprechung.
Laura Evans: Atlas der Kunstverbrechen. Diebstahl, Fälschung Vandalismus 224 S. Prestel. 34 Euro
Die lächelnde Lisa
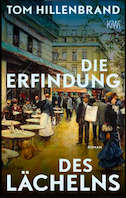 Mit dem Raub der Mona Lisa beschäftigt sich der Hamburger Schriftsteller Tom Hillenbrand in seinem Roman „Die Erfindung des Lächelns“. Mit leichten Veränderungen und Ergänzungen der Fakten hat er eine raffinierte, sehr unterhaltsame Geschichte geschrieben. Die Story braucht zwar etwas, bis sie so richtig Fahrt aufnimmt, aber dann folgt man den Ermittlungen zum Diebstahl ziemlich atemlos und trifft dabei auf Pablo Picasso, den Dichter Guillaume Apollinaire, die Tänzerin Isadora Duncan oder die Komponisten Igor Strawinsky und Claude Debussy. Was für ein Spaß!
Mit dem Raub der Mona Lisa beschäftigt sich der Hamburger Schriftsteller Tom Hillenbrand in seinem Roman „Die Erfindung des Lächelns“. Mit leichten Veränderungen und Ergänzungen der Fakten hat er eine raffinierte, sehr unterhaltsame Geschichte geschrieben. Die Story braucht zwar etwas, bis sie so richtig Fahrt aufnimmt, aber dann folgt man den Ermittlungen zum Diebstahl ziemlich atemlos und trifft dabei auf Pablo Picasso, den Dichter Guillaume Apollinaire, die Tänzerin Isadora Duncan oder die Komponisten Igor Strawinsky und Claude Debussy. Was für ein Spaß!
Tom Hillenbrand: Die Erfindung des Lächelns. 512 S., Kiwi Verlag. 25 Euro