|
|---|
Suchen
Kategorien
- Allgemein
- Ausstellungen
- Bad
- Bücher
- Cartoons
- Clippings + Was sagen Journalisten/Kunden
- DesignerIn
- Filme
- Food
- Genuss
- Hotels
- Idee
- Kolumne
- Kunsthandwerker/in
- Möbel
- Nice to know
- Porträts
- Produkte
- Quatsch des Monats
- Save the date
- Shops und Websites
- Stadtspaziergänge und Hotels
- Stimmen von Journalisten und Kunden
- Termine
- topmenu
- Und noch mehr
- Websites
- Wohnen
- Zitate
KuNo-Archiv
Login
Ausstellungen
Fondation Beyeler, Riehen/Basel noch bis 25.5.
Cézanne
Er gilt als Wegbereiter der klassischen Moderne, der Maler Paul Cézanne (1839-1906), der in der Provence lebte. Seine Zeitgenossen reagierten allerdings mit Unverständnis auf seine eigenwillige, den Kubismus vorwegnehmende Kunst, erst der Galerist Ambroise Vollard verhalf ihm 1895 mit einer Einzelausstellung in Paris zu größerer Bekanntheit.
Die Fondation Beyeler zeigt jetzt 80 Werke aus Cezannes Spätphase, Porträts, Landschaften und Ansichten seines Lieblingsbergs Montagne Sainte-Victoire.
Foto:Paul Cezanne, Baigneurs (Badende), ca. 1890, Öl auf Leinwand, 60,5 × 82,5 cm, Musée d’Orsay, Paris© GrandPalaisRMN (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski…
Luma, Arles
|
Museé Orsay, Paris
Was für eine Pracht! Und das war einmal ein Bahnhof mitten in Paris!
Entstanden ist er auf einem Grundstück direkt an der Seine, wo einst das Palais d’Orsay stand, das 1871 abbrannte. Am 14. Juli 1900 wurde der pompöse Neubau während der Weltausstellung eingeweiht, samt Hotel, in dem große Bankette und Tagungen stattfanden. Hotel und Bahnhof wurden auch gern als Kulisse genutzt, so drehte Orson Welles 1962 hier seinen Film „Der Prozess“ nach Franz Kafka.
Der Zugverkehr nahm allerdings – nicht zuletzt dank zu kurzer Bahnsteige – immer mehr ab, sodass man Mitte der siebziger Jahre tatsächlich darüber diskutierte, das Gebäude abzureißen und ein modernes Hotel zu errichten. 1977 dann initiierte der französische Präsident Giscard d’Estaing die Umwandlung in ein Museum, und 1978 wurde das Bauwerk unter Denkmalschutz gestellt.
Das Innere gestaltete die italienische Architektin und Designerin Gae Aulenti sehr behutsam um. Die große Bahnhofshalle bekam mehrere Nebengalerien mit darüber liegenden begehbaren Balkonen; unterm Dach und im ehemaligen Hotel entstanden große Ausstellungssäle.…
Fälschermuseum, Wien
 Sehr groß ist das Museum nicht, aber in dem Souterrain in der Wiener Löwengasse 28 kann man so einige Kleinode entdecken. Da hängt zum Beispiel Rembrandts „Selbstbildnis mit Saskia“ neben Vermeers „Christus und die Ehebrecherin“, und in einer Glasvitrine liegt eine Stradivari-Geige. Was für Schätze!
Sehr groß ist das Museum nicht, aber in dem Souterrain in der Wiener Löwengasse 28 kann man so einige Kleinode entdecken. Da hängt zum Beispiel Rembrandts „Selbstbildnis mit Saskia“ neben Vermeers „Christus und die Ehebrecherin“, und in einer Glasvitrine liegt eine Stradivari-Geige. Was für Schätze!
Und die haben eins gemeinsam: Sie sind allesamt gefälscht.
Auf jede echte Stradivari – so erfährt man hier – sind etwa 200 Kopien in Umlauf. Der Rembrandt etwa stammt von Edgar Mrugalla (1938 bis 2016), der zugab, etwa 3000 Gemälde nachgemalt zu haben. Und den Vermeer malte Han van Meegerens (1889 bis 1947) 1942 und verkaufte ihn an Hermann Göring. Als der Maler nach dem Krieg wegen Feindbegünstigung angeklagt wurde, gestand er seine Fälschungen ein.
Auch Konrad Kujau (1938 bis 2000) , dem Fälscher der Hitler-Tagebücher für das Magazin Stern von 1983, ist eine Vitrine gewidmet.
Ein durchaus interessanter, vielfältiger Museums-Besuch also, der mit einem Einkauf lustiger Postkarten, Accessoires und Bücher im Shop ergänzt werden kann.…
Grand Palais, Paris, noch bis 4. Januar 2026
Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten
 Alle zehn Minuten rasselt, klingelt, schnarrt die zimmergroße kinetische Skulptur los. Da drehen sich Räder, heben sich Gießkannen und Puppenköpfe, scheppern Blechdosen, Licht geht an und wieder aus.
Alle zehn Minuten rasselt, klingelt, schnarrt die zimmergroße kinetische Skulptur los. Da drehen sich Räder, heben sich Gießkannen und Puppenköpfe, scheppern Blechdosen, Licht geht an und wieder aus.
Das Werk des Schweizer Künstlers Jean Tinguely (1925 – 1991) ist derzeit im Grand Palais in Paris zu sehen, kombiniert mit Arbeiten seiner Frau Niki  de Saint Phalle (1939 – 2002), ihren fröhlich bunten Skulpturen und ihren Nanas aus Polyester. Dritter in dieser Ausstellung ist Pontus Hulten (1924 – 2006), der Gründungsdirektor des Moderna Museet in Stockholm und später des Centre Georges Pompidou in Paris, der das kreative Paar von Beginn an förderte und hier mit gewürdigt wird.
de Saint Phalle (1939 – 2002), ihren fröhlich bunten Skulpturen und ihren Nanas aus Polyester. Dritter in dieser Ausstellung ist Pontus Hulten (1924 – 2006), der Gründungsdirektor des Moderna Museet in Stockholm und später des Centre Georges Pompidou in Paris, der das kreative Paar von Beginn an förderte und hier mit gewürdigt wird.
Noch bis zum 4. Januar 2026 ist diese muntere Ausstellung, die so richtig Spaß macht, zu sehen. Foto: Grand Palais…
Industriemuseum, Chemnitz
 Was für eine Vielfalt: Gleich am Eingang stehen Autos auf einem silbernen Band, darunter ein Trabbi mit Zelt auf dem Dach neben einem Cabrio vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Untergeschoss kann man später eine Textilstraße mit den unterschiedlichsten Spinnmaschinen und Webstühlen besichtigen.
Was für eine Vielfalt: Gleich am Eingang stehen Autos auf einem silbernen Band, darunter ein Trabbi mit Zelt auf dem Dach neben einem Cabrio vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Untergeschoss kann man später eine Textilstraße mit den unterschiedlichsten Spinnmaschinen und Webstühlen besichtigen.
Das großartige Industriemuseum in Chemnitz residiert in einer ehemaligen Giesserei, 3500 qm groß, das Gebäude steht heute unter Denkmalschutz. Zu besichtigen in dem 1992 eröffneten Museum ist die 220jährige sächsische Industriegeschichte mit einer Lokomotive, einer Karosserieschweißanlage, mit der Melitta-Filtertüte, einem Knopfannähautomaten und vielen anderen erstaunlichen Dingen. Unbedingt besuchen! Foto: CO…
Bundeskunsthalle, Bonn, 1. August bis 11. Januar 2026
W.I.M. Die Kunst des Sehens
 Zum 80. Geburtstag des Filmemachers und Fotografen Wim Wenders (am 14. August) widmet ihm die Bundeskunsthalle eine große Ausstellung, in der Szenen seiner Filme, Fotoarbeiten und auch Collagen und Zeichnungen von ihm gezeigt werden.
Zum 80. Geburtstag des Filmemachers und Fotografen Wim Wenders (am 14. August) widmet ihm die Bundeskunsthalle eine große Ausstellung, in der Szenen seiner Filme, Fotoarbeiten und auch Collagen und Zeichnungen von ihm gezeigt werden.
Und so kann man noch einmal Ausschnitte aus „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ von 1972 sehen, „Der Amerikanische Freund“ von 1977, „Der Himmel über Berlin“ von 1987 und den mit einer Oscar-Nominierung geehrten Film „Buena Vista Social Club“ von 1999, aber auch aus seiner Dokumentation über Anselm Kiefer „Anselm – das Rauschen der Zeit“ von 2023. Requisiten, Produktionsunterlagen und ein „Audiowalk“, in dem Wenders einzelne Stationen seiner Karriere kommentiert, runden den Überblick über ein eindrucksvolles Werk ab, das nun schon mehr als fünf Jahrzehnte umfasst. Foto: Bruno Ganz im „Der Himmel über Berlin“…
Gut Hohen Luckow, Mecklenburg Vorpommern
 1707 ließ Christoph von Bassewitz das repräsentative Herrenhaus in Hohen Luckow ca. 20 km von Rostock entfernt im barocken Stil errichten. Mit etwa 1000 Hektar Land gehörte das Gut schon damals zu einem der größten in Mecklenburg.
1707 ließ Christoph von Bassewitz das repräsentative Herrenhaus in Hohen Luckow ca. 20 km von Rostock entfernt im barocken Stil errichten. Mit etwa 1000 Hektar Land gehörte das Gut schon damals zu einem der größten in Mecklenburg.
Heute bewirtschaftet man hier 2700 ha Acker, 65 ha Grünland und 65 ha Wald, außerdem gibt es 3000 Milchkühe.
Das gelb gestrichene Herrenhaus mit roten Fensterumrandungen bekam im 18. Jahrhundert zwei Seitentürme, in einem befinden sich heute Gästezimmer.
Unbedingt sehenswert ist der Rittersaal im zweiten Stock mit seiner herrlichen Stuckdecke und dem vergoldeten Kamin. Hier finden regelmäßig Konzerte statt. Im ersten Stock kann man eine große Fayencen- und Terrinen-Sammlung aus dem 17. und 18. Jahrhundert bewundern, die prächtigen Gefäße waren einst der Mittelpunkt jeder barocken Tafel.
Und auch im öffentlich zugänglichen Park rund ums Herrenhaus gibt es Sehenswertes: Hier stellen überwiegend Mecklenburger Künstler ihre Skulpturen aus. Foto: Gut Hohen Luckow…
Kunsthalle Hamburg, noch bis 12. Oktober
Rendezvous der Träume–
Surrealismus und Deutsche Romantik
 Eine überaus spannende Gegenüberstellung von Werken der deutschen Romantiker wie Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge und Surrealisten wie Max Ernst, René Magritte und Meret Oppenheim ist der Hamburger Kunsthalle hier gelungen. Dabei stehen 230 surrealistische Arbeiten etwa 70 romantischen gegenüber. Unterteilt ist die weitläufige Ausstellung in verschiedene Bereiche: Das „Rendezvous der Freunde“ etwa widmet sich dem 1924 gegründeten Kreis der Surrealisten und ihren Bezügen zu Romantikern wie Novalis, von Günderode und Brentano. In den „Passagen“ beschäftigt man sich mit Naturphänomenen wie Wolken und Wald, Meret Oppenheim liest eigene Gedichte, und es gibt interaktive Angebote. Im letzten Bereich „Kosmos“ geht es um das gesamte Universum.
Eine überaus spannende Gegenüberstellung von Werken der deutschen Romantiker wie Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge und Surrealisten wie Max Ernst, René Magritte und Meret Oppenheim ist der Hamburger Kunsthalle hier gelungen. Dabei stehen 230 surrealistische Arbeiten etwa 70 romantischen gegenüber. Unterteilt ist die weitläufige Ausstellung in verschiedene Bereiche: Das „Rendezvous der Freunde“ etwa widmet sich dem 1924 gegründeten Kreis der Surrealisten und ihren Bezügen zu Romantikern wie Novalis, von Günderode und Brentano. In den „Passagen“ beschäftigt man sich mit Naturphänomenen wie Wolken und Wald, Meret Oppenheim liest eigene Gedichte, und es gibt interaktive Angebote. Im letzten Bereich „Kosmos“ geht es um das gesamte Universum.
Neben den vielen Gemälden, Fotos und Objekten gibt es auch Filme zu sehen; ausführliche Texttafeln erläutern außerdem einzelne Bilder und ganze Bereiche. Und weil das Angebot dieser Ausstellung riesengroß ist, sollte man getrost einen zweiten Besuch erwägen.…
Vasa Museum, Stockholm
Was für eine Geschichte: 332 Jahre und 8 Monate lag das schwedische Kriegsschiff Vasa unter Wasser in den Schären vor Stockholm. Am 10. August 1628 war es unmittelbar nach dem Auslaufen nach nur 1300 Metern Fahrt in Schräglage geraten, durch die geöffneten Stückpforten voll Wasser gelaufen und gesunken. Wahrscheinlich ertranken 30 der etwa 200 Menschen an Bord. 1956 entdeckte der schwedische Hobbyforscher Anders Franzén die Vasa, und 1961 konnte sie gehoben werden. Fast zwanzig Jahre lang wurde das Schiff restauriert und schließlich 1988 in ein eigens gebautes Museum geschleppt, das am 15. Juni 1990 von König Carl XVI. Gustaf eröffnet wurde. Und seither kann man sich von sechs Stockwerken aus die stolze Vasa ansehen, und drumherum erfährt man in zahlreichen Schaukästen vom Leben auf so einem Schiff und kann gerettete Gegenstände betrachten.
Foto: CO…
Fondation Louis Vuitton, Paris, noch bis 31. August 2025
David Hockney 25
 Mehr als 400 Werke des Briten David Hockney (geb. 1937) stellt die Fondation Louis Vuitton in allen ihren Räumen aus. Gezeigt werden seine Arbeiten – Gemälde, Zeichnungen und digitale Werke – von 1955 bis 2025, einige Bilder sind extra für diese Ausstellung entstanden. Im Erdgeschoss kann man seine ersten, zum Teil riesigen Bilder erkunden, mit dabei sind zum Beispiel „Portrait of My Father“ von 1955 und „A bigger Splash“ von 1967. Im ersten Stock beeindrucken Werke, die sich mit der Normandie und ihren Landschaften beschäftigen und Hockneys Referenzen an Cézanne, Van Gogh und anderen belegen.
Mehr als 400 Werke des Briten David Hockney (geb. 1937) stellt die Fondation Louis Vuitton in allen ihren Räumen aus. Gezeigt werden seine Arbeiten – Gemälde, Zeichnungen und digitale Werke – von 1955 bis 2025, einige Bilder sind extra für diese Ausstellung entstanden. Im Erdgeschoss kann man seine ersten, zum Teil riesigen Bilder erkunden, mit dabei sind zum Beispiel „Portrait of My Father“ von 1955 und „A bigger Splash“ von 1967. Im ersten Stock beeindrucken Werke, die sich mit der Normandie und ihren Landschaften beschäftigen und Hockneys Referenzen an Cézanne, Van Gogh und anderen belegen.
Eine überwältigende Schau, die es in dieser Fülle noch nicht gegeben hat.
Foto: David Hockney, 27th March 2020, No. 1, 2020
iPad painting printed on paper, mounted on 5 panels Exhibition Proof 2 364.09 x 521.4 cm (143.343 x 205.276 Inches) © David Hockney…
Schloss Gottorf , Schleswig Holstein
Was für eine Pracht! Von außen ist das Schloss Gottorf nicht so spektakulär, aber vor allem die Säle im ersten Stock mit ihren Schätzen aus mehren Jahrhunderten sind wunderschön.
Die Ursprünge des Anwesens gehen auf eine Burg aus dem 14. Jahrhundert zurück, schließlich entstand ein Renaissanceschloss auf den Grundmauern, das Ende des 17. Jahrhunderts zu einer barocken Residenz umgestaltet wurde. Heute residiert hier das Museum für Kunst und Kulturgeschichte.
Unbedingt ansehen muss man sich die gotische Halle mit der Bogendecke, entstanden um 1500, in der ab 1667 die herzogliche Bibliothek untergebracht war. Auch im Saal Friedrichs III. von 1625 ist die Decke ganz besonders: Sie wurde vom Stukkateur Hans Georg Ritteln mit plastischen Fruchtbündeln dekoriert. Die Schlosskapelle von 1590 mit Empore für den Adel und Betstube für die Herzogfamilie ist noch immer in ihrem erbauten Zustand. Nicht so der Hirschsaal von 1595, der 1931 rekonstruiert wurde, nur der Hirsch über dem Kamin ist noch als Original erhalten.…
Zeitgeschichtliches Forum Leipzig
Unsere Geschichte – Diktatur und Demokratie nach 1945
 Es ist wirklich eine einzigartige Dauer-Ausstellung, die man im Leipziger zeitgeschichtlichem Forum besuchen kann. Gezeigt wird deutscher Alltag in der Nachkriegszeit, in beiden deutschen Staaten, während der friedlichen Revolution und nach der Wiedervereinigung. Da steht ein Trabbi neben Jeans in Ost und West, zeigen Fotos das Schlangestehen vor dem Konsum, LP-Sammlungen dokumentieren den Geschmack westdeutscher Jugendlicher, und Plakate, Postkarten und Schriftstücke zeigen den wechselnden Zeitgeist. Und die handschriftlichen Notizen von Günter Schabowski zur neuen Reisereglung, die 1989 zur Grenzöffnung führte, fehlen selbstverständlich auch nicht.
Es ist wirklich eine einzigartige Dauer-Ausstellung, die man im Leipziger zeitgeschichtlichem Forum besuchen kann. Gezeigt wird deutscher Alltag in der Nachkriegszeit, in beiden deutschen Staaten, während der friedlichen Revolution und nach der Wiedervereinigung. Da steht ein Trabbi neben Jeans in Ost und West, zeigen Fotos das Schlangestehen vor dem Konsum, LP-Sammlungen dokumentieren den Geschmack westdeutscher Jugendlicher, und Plakate, Postkarten und Schriftstücke zeigen den wechselnden Zeitgeist. Und die handschriftlichen Notizen von Günter Schabowski zur neuen Reisereglung, die 1989 zur Grenzöffnung führte, fehlen selbstverständlich auch nicht.
Eine großartige Ausstellung, die man sich immer wieder ansehen sollte.
Foto: Zeitgeschichtliches Forum Leipzig…
Schloss Nymphenburg, München
Schloss Nymphenburg wurde 1664 als Sommerresidenz von Kurfürst Ferdinand Maria und seiner Frau Henriette Adelaide von Savoyen anlässlich der Geburt ihres Sohnes Max Emanuel nach italienischen Vorbildern errichtet. Zunächst bestand es nur aus einem mächtigen kubischen Pavillon, der aber dann von Sohn Max Emanuel ab 1701 um die etwas kleineren Gebäude rechts und links samt verbindender Galerien erweitert wurde. Ab 1715, nach fast zehn Jahren in Paris, ließ Max Emanuel vom Hofbaumeister Joseph Effner und dem französischen Gartenarchitekten Dominique Girard Nymphenburg als vollkommen symmetrische „Idealstadt“ entwerfen und bauen. Dazu wurden Nebengebäude zu Hofgevierten, ein halbkreisförmiges Rondell und fünf kleinere Schlösser im Park errichtet. Auch die Innenräume wurden kostbar ausgestattet, so gilt die Amalienburg als Kleinod des Rokoko. 1792 öffnete Kurfürst Karl Theodor den Park für die Öffentlichkeit.
Heute kann man auch das Geburtszimmer von König Ludwig II. von Bayern im Schloss besichtigen. Foto: CO…
Museum der Arbeit, Hamburg
 Ab 1863 baute man in der Hansestadt den Bach Barnebeke (daraus entstand der Name Barmbek) zum Osterbekkanal um, an dem sich dann mehrere Fabriken niederliessen. Mit dabei war die New York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie (NYH), die aus dem Hafen importierten Kautschuk bekam und zu Hartgummi- Produkten wie Kämmen oder Tabakpfeifen verarbeitete. 1954 gab die NYH den Firmensitz auf.
Ab 1863 baute man in der Hansestadt den Bach Barnebeke (daraus entstand der Name Barmbek) zum Osterbekkanal um, an dem sich dann mehrere Fabriken niederliessen. Mit dabei war die New York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie (NYH), die aus dem Hafen importierten Kautschuk bekam und zu Hartgummi- Produkten wie Kämmen oder Tabakpfeifen verarbeitete. 1954 gab die NYH den Firmensitz auf.
1997 zog in die schön restaurierten Fabrikgebäude das Museum der Arbeit ein, das die Geschichte der Arbeit in Hamburg seit der Industrialisierung ausstellt. Gezeigt werden Maschinen, Werkzeuge, Kleidung und viele Fotos, erzählt werden Lebensgeschichten von vielen Arbeitern. In einer großen Druckerwerkstatt kann man die Entwicklung des graphischen Gewerbes verfolgen. Im Hof des Museums steht u.a. das Schneiderad (380 Tonnen schwer, Durchmesser 14,2 m), genannt T.R.U.D.E (Tief runter unter die Elbe), mit dem zwischen 1997 und 2000 die Elbe untertunnelt wurde. Foto: Die T:R:U:D:E am Museum der Arbeit hamburg.de…
Bucerius Kunst Forum, Hamburg noch bis 1.Juni 2025:
In her hands. Bildhauerinnen des Surrealismus
 Licht – entschieden die Kuratorinnen – brauchen diese Skulpturen, und zwar jede Menge. Also zogen sie die Vorhänge zurück und ließen in den großen, diesmal kaum unterteilten Raum des Bucerius Forums das Tageslicht hinein.
Licht – entschieden die Kuratorinnen – brauchen diese Skulpturen, und zwar jede Menge. Also zogen sie die Vorhänge zurück und ließen in den großen, diesmal kaum unterteilten Raum des Bucerius Forums das Tageslicht hinein.
Und das haben die drei fast unbekannten surrealistischen Bildhauerinnen, die Schweizerin Isabelle Waldberg (1911-1990), die Dänin Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984) und die Brasilianerin Maria Martins (1894-1973), wirklich verdient, schließlich waren sie in Paris vor 1939 Teil der Avantgarde, deren Arbeiten bis heute verblüffen. Sehr kleine Objekte aus Holz („Lebende Zweige“ von Sonja Mancoba) stehen nun neben bemalten Eisenobjekten („Wandkonstruktion“ von Isabelle Waldberg) und riesigen Bronzeobjekten („The Impossible“ von Maria Martins). Das Ergebnis: eine ungewohnte, leicht irritierende und sehr beeindruckende Schau. Foto: Bucerius Kunst Forum…
Auf den ersten Blick ist es alles andere als attraktiv, das Kunst- und Kulturzentrum „TEA“ (Tenerife Espacio de las Artes) in Teneriffas Hauptstadt. Von außen ist es nur ein langer, sehr flacher Bau aus dunkelgrauem Beton mit Glasbausteinen. Eine Glasfront hat nur der Shop – dann aber kommt man durch ein schmalesTor in einen beeindruckenden Innenhof, der leicht abfallend einmal durchs ganze Gebäude reicht und der auch für Theateraufführungen und Konzerte genutzt wird. Links und rechts gewähren große Glasfronten Einblick ins Untergeschoss mit der Bibliothek und vielen Arbeitsplätzen.
Das „TEA“ wurde vom Schweizer Architekten-Duo Herzog & de Meuron zusammen mit dem ortsansässigen Architekten Virgilio Guitérrez entworfen und 2008 fertig gestellt. Auf über 20 000 qm gibt es neben der Bibliothek Ausstellungsflächen, Kino- und Vortragssäle und das Zentrum für Fotografie.
Das Gebäude schmiegt sich ans Ufer des meist ausgetrockneten Barranco de Santos, gegenüber liegt der sehenswerte Markt „Nuestra Senora de Africa“, über eine Brücke erreicht man die Altstadt von Santa Cruz de Tenerife. …
Deutsches Historisches Museum, Berlin, noch bis 6. April 2025:
Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert
 Ja, was ist denn eigentlich Aufklärung, hat sich das Historische Museum in Berlin gefragt und ist auf jede Menge weitere Fragen gekommen. Denn in der bis heute wichtigsten Epoche der jüngeren Menschheitsgeschichte, die das ganze 18. Jahrhundert prägte, wurde nicht nur rationales Denken zur Richtschnur allen Handelns erklärt, man kämpfte gegen Vorurteile, trat für religiöse Toleranz und die allgemeinen Menschenrechte ebenso ein wie für das Recht auf Bildung und wollte den Fortschritt auch durch verstärkte Hinwendung zu den Naturwissenschaften befördern. Zu all diesen und mehr Bereichen finden sich Beispiele, Schautafeln, Texte, Fotos und Filme. Eine wirklich interessante, gut gemachte Ausstellung, die man nicht versäumen sollte.
Ja, was ist denn eigentlich Aufklärung, hat sich das Historische Museum in Berlin gefragt und ist auf jede Menge weitere Fragen gekommen. Denn in der bis heute wichtigsten Epoche der jüngeren Menschheitsgeschichte, die das ganze 18. Jahrhundert prägte, wurde nicht nur rationales Denken zur Richtschnur allen Handelns erklärt, man kämpfte gegen Vorurteile, trat für religiöse Toleranz und die allgemeinen Menschenrechte ebenso ein wie für das Recht auf Bildung und wollte den Fortschritt auch durch verstärkte Hinwendung zu den Naturwissenschaften befördern. Zu all diesen und mehr Bereichen finden sich Beispiele, Schautafeln, Texte, Fotos und Filme. Eine wirklich interessante, gut gemachte Ausstellung, die man nicht versäumen sollte.
Foto: Modell eines menschlichen Auges im Behältnis, Nürnberg, um 1700 © Deutsches Historisches Museum …
Von der Heydt Museum, Wuppertal
1842 baute der Schinkel-Schüler Johann Peter Cremer den dreiflügeligen Sandsteinbau als Rathaus der Stadt Elberfeld auf den Resten einer verfallenen Kirche, die wiederum auf einer abgebrannten Burg stand. Cremer entwarf einen klassizistischen Bau mit Blendarkaden in drei Stockwerken, die nach oben enger werden. Über den Eingang setzte der Architekt einen Balkon mit gusseiserner Brüstung.
Seit 1902 residiert hier das von der Heydt-Museum, benannt nach einem der Gründer des Elberfelder Museumsvereins, dem Bankier August Freiherr von der Heydt. Er und seine Nachfahren stifteten dem Museum viele bedeutende Werke, u.a. von Monet, van Gogh und Picasso.
1985 bis 1990 überbauten die Kölner Architekten Peter Busmann und Godfried Haberer den Innenhof und schufen so mehr Ausstellungsfläche, 2007 bekam das Museum eine neue Lüftungsanlage und alle Räume erhielten Lichtdecken.
Die bedeutende Sammlung des Museums umfasst heute Gemälde, Skulpturen, Grafiken und Fotografien, mit Schwerpunkten bei den Gemälden der französischen Kunst des 19.…
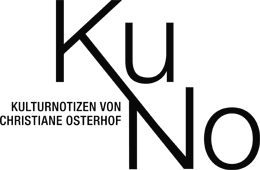

 Gerade ist er gestorben, der geniale, kanadisch-amerikanische Architekt Frank Gehry (geb. 1929), der u.a. das Museum Guggenheim in Bilbao, die Fondation Louis Vuitton in Paris und das Vitra Design Museum in Weil am Rhein entwarf, und der auch den 56m hohen Turm „Luma“ in Arles gebaut hat.
Gerade ist er gestorben, der geniale, kanadisch-amerikanische Architekt Frank Gehry (geb. 1929), der u.a. das Museum Guggenheim in Bilbao, die Fondation Louis Vuitton in Paris und das Vitra Design Museum in Weil am Rhein entwarf, und der auch den 56m hohen Turm „Luma“ in Arles gebaut hat.