Er gehört mittlerweile zum Weltkulturerbe, der Palazzo Ducale in der kleinen Renaissance-Stadt Urbino mitten in Italiens Marken. Erbaut wurde er im Auftrag des Grafen Federico da Montefeltro zwischen 1463 und 1472 vom Architekten Luciano Laurana, der den Palast mit Säulenarkaden im rechteckigen Innenhof und zwei Rundtürmen an der Westfassade verzierte. Besonders sehenswert ist das sogenannte „Studiolo“, ein nur 3,60 x 3,35 m großer Raum mit feinsten Intarsien, Trompe-l’oeil-Malereien und offenen Gittertüren, der als Arbeit- und Gebetsraum genutzt wurde.
Heute residiert im Palazzo Ducale die „Galleria Nazionale delle Marche“ mit einer der bedeutendsten Kunstsammlungen der Renaissance weltweit, darunter Gemälde von Raffael (1483-1520), dem berühmtesten Sohn der Stadt.
Foto: CO…
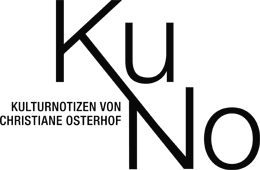
 Als er – alt und gebrechlich wie er mit Anfang siebzig war – nicht mehr malen konnte, griff er zur Schere, und siehe da: Auch damit gelangen Henri Matisse wunderbare Meisterwerke. Sie sind der letzte Höhepunkt einer über fünf Jahrzehnte währenden Künstlerlaufbahn, die den Franzosen, der anfangs Jura studierte, bevor er während einer Krankheit anderen Sinnes wurde und beschloss, sich ganz der Kunst zu widmen, zu einem der Großen der Klassischen Moderne machte. Von den impressionistischen Anfängen über die aufregende Fauvisten-Phase bis hin zu den eleganten Scherenschnitten entstand ein Werk, das mit seinen Odalisken, Ornamenten und offenen Fenstern zu den schönsten und beglückendsten des 20. Jahrhunderts zählt. Gerade zu bewundern in der Fondation Beyeler bei Basel, die dem Meister in ihrem Haus mit gut 70 Arbeiten eine ebenso kleine wie feine Retrospektive widmet. PM
Als er – alt und gebrechlich wie er mit Anfang siebzig war – nicht mehr malen konnte, griff er zur Schere, und siehe da: Auch damit gelangen Henri Matisse wunderbare Meisterwerke. Sie sind der letzte Höhepunkt einer über fünf Jahrzehnte währenden Künstlerlaufbahn, die den Franzosen, der anfangs Jura studierte, bevor er während einer Krankheit anderen Sinnes wurde und beschloss, sich ganz der Kunst zu widmen, zu einem der Großen der Klassischen Moderne machte. Von den impressionistischen Anfängen über die aufregende Fauvisten-Phase bis hin zu den eleganten Scherenschnitten entstand ein Werk, das mit seinen Odalisken, Ornamenten und offenen Fenstern zu den schönsten und beglückendsten des 20. Jahrhunderts zählt. Gerade zu bewundern in der Fondation Beyeler bei Basel, die dem Meister in ihrem Haus mit gut 70 Arbeiten eine ebenso kleine wie feine Retrospektive widmet. PM Das Haus wurde 1895 vom Architekten Gustaf Nyström als Schule im neugotischen Stil errichtet – das Museum gibt es schon 150 Jahre. Doch erst 1978 konnte es diesen Prachtbau beziehen, seit 2002 heißt es Design-Museum. Gezeigt wird die Geschichte des finnischen Designs seit 1870, das Haus besitzt immerhin über 75.000 Objekte und 40.000 Zeichnungen, und immer wieder gibt es Sonderausstellungen..
Das Haus wurde 1895 vom Architekten Gustaf Nyström als Schule im neugotischen Stil errichtet – das Museum gibt es schon 150 Jahre. Doch erst 1978 konnte es diesen Prachtbau beziehen, seit 2002 heißt es Design-Museum. Gezeigt wird die Geschichte des finnischen Designs seit 1870, das Haus besitzt immerhin über 75.000 Objekte und 40.000 Zeichnungen, und immer wieder gibt es Sonderausstellungen.. Nach Michel und Elphi hat Hamburg jetzt eine weitere Attraktion: den begrünten Bunker an der Feldstraße.
Nach Michel und Elphi hat Hamburg jetzt eine weitere Attraktion: den begrünten Bunker an der Feldstraße. Eine Schere und reichlich Kleister: viel mehr brauchte Hannah Höch (1889-1978) nicht, um sich für ihre Kunst ans Werk zu machen – und eine neue, ganz eigene Welt zu erschaffen. Vor allem Fotografien, ausgerissen aus Zeitungen und Zeitschriften, hatten es ihr angetan. Beherzt zerschnippelte sie die Bilder und kombinierte die Fragmente zu einer neuen, oft ebenso phantasievollen wie verblüffenden Wirklichkeit. So wurde die Tochter aus bürgerlichem Haus, die sich nach dem Ersten Weltkrieg der Dada-Bewegung anschloss, zur Miterfinderin der Collage; als die Nazis ihre Arbeiten als „entartet“ verfemten, zog sie sich fast völlig aus dem Kunstleben zurück und wurde erst nach 1945 allmählich wiederentdeckt. Das Untere Belvedere in Wien zeigt jetzt noch bis zum 9. Oktober mit vielen ihrer Collagen, aber auch Gemälden und Zeichnungen, welch originellen Beitrag die vielseitige Künstlerin zur Avantgarde geleistet hat. PM
Eine Schere und reichlich Kleister: viel mehr brauchte Hannah Höch (1889-1978) nicht, um sich für ihre Kunst ans Werk zu machen – und eine neue, ganz eigene Welt zu erschaffen. Vor allem Fotografien, ausgerissen aus Zeitungen und Zeitschriften, hatten es ihr angetan. Beherzt zerschnippelte sie die Bilder und kombinierte die Fragmente zu einer neuen, oft ebenso phantasievollen wie verblüffenden Wirklichkeit. So wurde die Tochter aus bürgerlichem Haus, die sich nach dem Ersten Weltkrieg der Dada-Bewegung anschloss, zur Miterfinderin der Collage; als die Nazis ihre Arbeiten als „entartet“ verfemten, zog sie sich fast völlig aus dem Kunstleben zurück und wurde erst nach 1945 allmählich wiederentdeckt. Das Untere Belvedere in Wien zeigt jetzt noch bis zum 9. Oktober mit vielen ihrer Collagen, aber auch Gemälden und Zeichnungen, welch originellen Beitrag die vielseitige Künstlerin zur Avantgarde geleistet hat. PM Die Hansestadt Uelzen hat schon seit 1847 einen Bahnhof an der Strecke Hannover-Harburg. Als regionalen Beitrag zum Projekt der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover beschloß die Stadt, ihn in einen „Umwelt- und Kulturbahnhof“ zu verwandeln und beauftragte den Wiener
Die Hansestadt Uelzen hat schon seit 1847 einen Bahnhof an der Strecke Hannover-Harburg. Als regionalen Beitrag zum Projekt der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover beschloß die Stadt, ihn in einen „Umwelt- und Kulturbahnhof“ zu verwandeln und beauftragte den Wiener  Künstler Friedensreich Hundertwasser (1928 bis 2000) mit einem Konzept. Und so schuf der Maler, Architekt und Ökologe ein Beispiel für „natur- und menschengerechte Architektur“, wie es auf einer Tafel im Bahnhof heißt.
Künstler Friedensreich Hundertwasser (1928 bis 2000) mit einem Konzept. Und so schuf der Maler, Architekt und Ökologe ein Beispiel für „natur- und menschengerechte Architektur“, wie es auf einer Tafel im Bahnhof heißt. Hat da jemand gesagt, die DDR sei ein muffiger, langweiliger Spießer-Staat gewesen? In der Rostocker Kunsthalle ist noch bis zum 8. September zu besichtigen, dass etlichen „unserer Brüder und Schwestern im Osten“ durchaus der Sinn nach Spaß, Kurzweil und Vergnügen stand. Nicht gerade in aller Öffentlichkeit, aber privat, in Vereinen oder Kombinaten entwickelte man beträchtliche Phantasie und Tatkraft, um dem tristen Alltag zumindest für ein paar Stunden zu entkommen. Und so zeigen die rund 300 Fotos von „Der große Schwof“ und „Rostock tanzt“ lustige Paare, lockere Runden, mehr oder weniger standfeste Trinker und überhaupt jede Menge Kontrastprogramm zum offiziell verordneten Frohsinn.
Hat da jemand gesagt, die DDR sei ein muffiger, langweiliger Spießer-Staat gewesen? In der Rostocker Kunsthalle ist noch bis zum 8. September zu besichtigen, dass etlichen „unserer Brüder und Schwestern im Osten“ durchaus der Sinn nach Spaß, Kurzweil und Vergnügen stand. Nicht gerade in aller Öffentlichkeit, aber privat, in Vereinen oder Kombinaten entwickelte man beträchtliche Phantasie und Tatkraft, um dem tristen Alltag zumindest für ein paar Stunden zu entkommen. Und so zeigen die rund 300 Fotos von „Der große Schwof“ und „Rostock tanzt“ lustige Paare, lockere Runden, mehr oder weniger standfeste Trinker und überhaupt jede Menge Kontrastprogramm zum offiziell verordneten Frohsinn. Der Franzose Henri Cartier-Bresson (1908 bis 2004) begann 1930 zu fotografieren und wurde schnell bekannt für seine ungewöhnlichen, ganz auf die Magie des Augenblicks konzentrierten Schwarzweißbilder. So fotografierte er bei der Krönung Georgs VI. in London, war im Spanischen Bürgerkrieg dabei, schloss sich 1943 der Résistance an und nahm die geschlagenen deutschen Truppen 1945 beim Abzug auf. 1947 gründete er zusammen mit Robert Capa und anderen die Fotoagentur Magnum mit Sitz in New York. In den nächsten Jahren reiste er nach Indien, China, Indonesien, Mexiko, Kuba und auch in die Sowjetunion und brachte beeindruckende Reportagen mit.
Der Franzose Henri Cartier-Bresson (1908 bis 2004) begann 1930 zu fotografieren und wurde schnell bekannt für seine ungewöhnlichen, ganz auf die Magie des Augenblicks konzentrierten Schwarzweißbilder. So fotografierte er bei der Krönung Georgs VI. in London, war im Spanischen Bürgerkrieg dabei, schloss sich 1943 der Résistance an und nahm die geschlagenen deutschen Truppen 1945 beim Abzug auf. 1947 gründete er zusammen mit Robert Capa und anderen die Fotoagentur Magnum mit Sitz in New York. In den nächsten Jahren reiste er nach Indien, China, Indonesien, Mexiko, Kuba und auch in die Sowjetunion und brachte beeindruckende Reportagen mit. Das Museum für Komische Kunst residiert im Leinwandhaus von etwa 1400, einem der ältesten Profanbauten Frankfurts, der aussieht wie ein Schlösschen mit Zinnen und Türmchen. Über die Jahrhunderte diente es dem Tuchhandel, war mal Gericht und Gefängnis, mal Lazarett oder Schlachthaus, mal lebten dort Stadtschreiber oder Geisteskranke, und zeitweise gab es hier ein Stadtmuseum oder eine Galerie. Im Krieg schwer zerstört, wurde es schließlich 1984 wieder aufgebaut. Für den gelungenen Umbau zum Museum bekam das Architekturbüro Diezinger + Kramer 2011 den „best architect award“.
Das Museum für Komische Kunst residiert im Leinwandhaus von etwa 1400, einem der ältesten Profanbauten Frankfurts, der aussieht wie ein Schlösschen mit Zinnen und Türmchen. Über die Jahrhunderte diente es dem Tuchhandel, war mal Gericht und Gefängnis, mal Lazarett oder Schlachthaus, mal lebten dort Stadtschreiber oder Geisteskranke, und zeitweise gab es hier ein Stadtmuseum oder eine Galerie. Im Krieg schwer zerstört, wurde es schließlich 1984 wieder aufgebaut. Für den gelungenen Umbau zum Museum bekam das Architekturbüro Diezinger + Kramer 2011 den „best architect award“.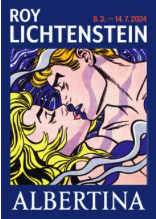 Der Amerikaner Roy Lichtenstein (1923-1997) gehört neben Andy Warhol zu den Stars der Pop Art. Die Albertina zeigt jetzt mehr als 90 Gemälde, Skulpturen und Grafiken, darunter viele Leihgaben aus internationalen Museen wie dem New Yorker Moma und dem Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid. Zu sehen sind u.a. Lichtensteins Frühwerke aus den 1960er Jahren, seine Gemälde von Objekten aus der Werbung und eine seiner riesigen Brushstroke-Skulpturen, bei denen ein scheinbar spontaner Pinselstrich auf die Werke der Expressionisten Jackson Pollock und Willem de Kooning Bezug nimmt.
Der Amerikaner Roy Lichtenstein (1923-1997) gehört neben Andy Warhol zu den Stars der Pop Art. Die Albertina zeigt jetzt mehr als 90 Gemälde, Skulpturen und Grafiken, darunter viele Leihgaben aus internationalen Museen wie dem New Yorker Moma und dem Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid. Zu sehen sind u.a. Lichtensteins Frühwerke aus den 1960er Jahren, seine Gemälde von Objekten aus der Werbung und eine seiner riesigen Brushstroke-Skulpturen, bei denen ein scheinbar spontaner Pinselstrich auf die Werke der Expressionisten Jackson Pollock und Willem de Kooning Bezug nimmt.